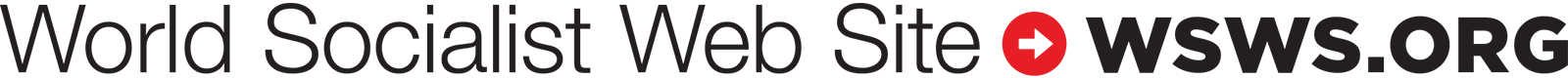Wer den Berliner SPD-Parteitag am vergangenen Wochenende verfolgt hat, muss auf die Frage: „Gibt es für die Sozialdemokraten Grenzen des Niedergangs und politischen Bankrotts?“ einmal mehr mit „Nein“ antworten.
Vor dem Parteitag hatte die Zentrale im Willy-Brandt-Haus die Parole ausgegeben, vor allem müsse das desaströse Wahlergebnis der letzten Bundestagswahl im Februar aufgearbeitet werden. Die SPD hatte mit 16,4 Prozent ihr historisch schlechtestes Ergebnis erzielt. Doch während des Parteitags setzte die Führungsriege um Parteichef Lars Klingbeil und Verteidigungsminister Boris Pistorius genau die Politik durch, die zu den massiven Stimmenverlusten geführt hatte und sie sogar noch verschärft.
Der eigentliche Auftakt zum Parteitag fand bereits zuvor im Bundestag statt, als die SPD-Bundestagsfraktion nahezu geschlossen einem massiven Angriff auf Flüchtlinge und Asylsuchende zustimmte. Unter anhaltendem Beifall der AfD-Abgeordneten beschloss der Bundestag die Aussetzung des Familiennachzugs für Menschen mit sogenanntem subsidiären Schutzstatus. Es sind laut Pro Asyl Schutzberechtigte, denen bei einer Rückkehr in den Herkunftsstaat ein ernsthafter Schaden droht, auch wenn sie nach der Genfer Flüchtlingskonvention von 1951 keine eigentliche Flüchtlingseigenschaft aufweisen. Sie sind vor Krieg und Bürgerkrieg geflohen und leben oft schon seit Jahren in der Bundesrepublik, ohne ihre Eltern, Kinder, Partnerinnen und Partner. Nun hat ihnen der Bundestag auch die schon bisher schwierige Möglichkeit der Familienzusammenführung entzogen. Nur zwei SPD-Abgeordnete widersetzten sich der Fraktionsdisziplin und stimmten gegen diese brutale und unmenschliche Entscheidung, mit der der Bundestag die Politik der AfD übernimmt.
Zur Eröffnung des Parteitages appellierte Parteichef Lars Kleinbeil an die Geschlossenheit des Parteiapparats. „In schwierigen Zeiten“ sei es notwendig, zusammenzurücken. Kritik müsse sich „im Rahmen halten“ und dürfe „das notwendige Maß an Solidarität unter Sozialdemokraten“ nicht unterschreiten. „Flügelkämpfe, Personaldebatten, Durchstechereien oftmals auf Kosten der Vorsitzenden“ hätten in der Vergangenheit viel Schaden angerichtet.
Zu dem miserablen Wahlergebnis und der Untergangsstimmung, die in der Partei vorherrscht, sagte Klingbeil, er lese immer wieder Kommentare und Leitartikel, die behaupten: „Eigentlich braucht es die Sozialdemokratie doch gar nicht mehr.“ Und er antwortete: „Ich sage euch ganz offen, ich habe mich im Vorfeld dieses Parteitages auch gefragt: Haben wir einen Punkt erreicht, an dem man die Frage stellen muss: Braucht es die Sozialdemokratie noch?“ Er habe lange nachgedacht und sei zu der Schlussfolgerung gekommen, „dass es genau umgekehrt ist“.
Die SPD sei gerade heute, „in Zeiten großer Unsicherheit, Umbrüche, wirtschaftlicher Probleme und von Angriffen auf Frieden und Freiheit“ wichtiger denn je. Eine Partei, die nicht polarisiere, sondern Brücken baue, sei dringend erforderlich. Klingbeil wörtlich: „Gerade in diesen Zeiten braucht es eine Partei, die weiß, dass militärische Stärke auf der einen Seite und Diplomatie keine Gegensätze sind, sondern dass man beides zusammenbringen muss, um eine Politik zu machen für unser Land.“
Deutlicher kann man die historische Rolle der Sozialdemokratie in den vergangenen 111 Jahren, seit ihrer Zustimmung zu den Kriegskrediten im Sommer 1914 am Beginn des Ersten Weltkriegs, kaum beschreiben. In allen großen Krisen des deutschen Imperialismus spielte die SPD eine Schlüsselrolle, um den Klassenkampf zu unterdrücken und die herrschende Klasse der Kapitalisten an der Macht zu halten. Im Dienst des deutschen Imperialismus war sie auch immer bereit, die eigenen Parteiinteressen zurückzustellen und Wahlniederlagen hinzunehmen.
Hatte die Partei in der Vergangenheit noch die Unterstützung breiterer Schichten von Arbeitern, ist sie heute praktisch nur noch auf ihren Apparat reduziert, der aufs engste mit dem Staat verwoben ist. Die Aufrechterhaltung der kapitalistischen Ordnung ist der Partei zur Natur geworden, und sie setzt Sozialkürzungen und Krieg mit allen Mitteln durch, auch wenn das den eigenen Untergang bedeutet.
Von diesem Standpunkt aus muss man auch die Wahlschlappe Klingbeils betrachten. Bei der Wahl zum Vorsitzenden erhielt er mit 64,9 Prozent der Delegiertenstimmen das schlechteste Ergebnis in der Geschichte der SPD. Doch dieses Misstrauensvotum richtete sich nicht gegen die rechte Politik der militaristischen Aufrüstung, die Klingbeil und der gesamte Parteivorstand vertreten, und auch nicht gegen die Sozialkürzungen, mit denen diese Aufrüstung finanziert wird, die er als Finanzminister durchsetzt.
Vielmehr war die Wahl-Klatsche die Art und Weise, wie die Parteitagsdelegierten verlangten, dass die rechte Politik so verpackt und durchgesetzt werde, dass ihre eigenen lukrativen Posten in der Bundes-, Landes- und Kommunalpolitik nicht gefährdet würden.
Anschließend sprach Verteidigungsminister Boris Pistorius und wiederholte seine bekannte Propaganda, dass Deutschland dringend „wehrhaft und kriegstüchtig“ werden müsse. Er rechtfertigte die wahnwitzigen Summen für Aufrüstung und militärische Infrastruktur in Billionenhöhe. Als größte Volkswirtschaft Europas müsse Deutschland künftig eine zentrale Rolle spielen und einen besonderen Beitrag leisten.
Mit dem Argument, man müsse „reagieren können, wenn die sicherheitspolitische Lage oder die Bedarfe der Bundeswehr dies erfordern“, rechtfertigte Pistorius die Beschlüsse des jüngsten Nato-Gipfels, der Anfang vergangener Woche in Den Haag die umfassendste Aufrüstung Europas seit dem Zweiten Weltkrieg vereinbarte. Statt bisher 2 sollen künftig 5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) für Kriegszwecke ausgegeben werden, davon 3,5 Prozent für rein militärische Ausgaben wie Truppen und Waffen und weitere 1,5 Prozent für erweiterte Maßnahmen wie Cybersicherheit, Infrastruktur und den Bau von Kasernen.
Pistorius ließ keinen Zweifel daran, wer für diese Militarisierung bezahlen soll. Bereits in früheren Reden hatte er betont: „Mit Sozialleistungen und mit Bildung lässt sich dieses Land nicht verteidigen.“ Es ist bekannt, dass die Bundesregierung längst damit begonnen hat, Haushaltsgelder von sozialen und ökologischen Projekten in die Rüstung zu verschieben.
Als der Verteidigungsminister erklärte, man müsse der Realität ins Auge blicken, die Bundeswehr sei personell unterbesetzt und „die Zielvorgabe, mindestens 60.000 zusätzliche Soldaten und 200.000 Reservisten“ zu gewinnen, müsse umgesetzt werden, wurde seine Rede von einigen Jungsozialisten unterbrochen. Sie riefen Parolen wie: „Abrüstung und Demokratie – statt Aufrüstung und Krieg“ und hielten Transparente hoch. Später trat der Vorsitzende der Jusos, Philipp Türmer, ans Mikrophon. Er begründete einen Initiativantrag zur Ablehnung der Wiedereinführung eines Wehrdiensts als Pflicht. Eine Rückkehr zum Zwangsdienst sei nicht akzeptabel, betonte er.
Pistorius wollte in seinem geplanten Wehrdienstgesetz bereits Zwangsregelungen einbauen, die bei einem Fehlen von Freiwilligen greifen würden. Er sprach sich deutlich gegen diejenigen aus, „die meinen, wir müssten jegliche Verpflichtung ausschließen“. Dagegen ergriffen mehrere Jusos das Wort und betonten, eine „Rückkehr zur alten Wehrpflicht“ sei inakzeptabel. Der Dienst bei der Bundeswehr müsse so attraktiv gestaltet werden, dass genügend Freiwillige rekrutiert werden könnten.
Schließlich einigte sich der Parteitag mit wenigen Gegenstimmen darauf, die Entscheidung, ob Wehrpflicht oder nicht, erst dann zu treffen, wenn sie unmittelbar ansteht. Im mehrheitlich verabschiedeten Kompromiss heißt es, dass die Partei sich zu einem „neuen Wehrdienst“ nach dem sogenannten schwedischen Modell bekenne, wie es auch im Koalitionsvertrag mit CDU/CSU verabredet ist.
Damit wurde klar, aus welchem Grund die Jusos einen militärischen Pflichtdienst ablehnen: Es geht ihnen nicht um prinzipielle Überlegungen, sondern um pures Eigeninteresse. Wie ihr Vorsitzender Philipp Türmer (Vater: Volljurist und ehem. Leiter der Rechtsabteilung des Bundesinnenministeriums; Mutter: Oberstaatsanwältin) kommen die meisten dieser SPD-Zöglinge aus privilegiertem Hause; sie wollen ihre Karriere nicht durch Dienst beim Barras unterbrechen und sind nicht bereit, für ihre eigene Kriegspolitik im Schützengraben zu liegen.
Stattdessen sollen Arbeiterjugendliche in den Militärdienst getrieben werden. Ihnen wird der Zugang zu Hochschulbildung immer weiter erschwert, und in vielen Regionen finden sie nicht einmal einen vernünftigen Ausbildungsplatz. Aus ihren Reihen soll das künftige Kanonenfutter gestellt werden.
Zum Abschluss des Parteitages herrschte große Einigkeit der 600 Delegierten. Ohne Gegenstimme oder Enthaltung wurde ein Antrag des Parteivorstands angenommen, der die Einsetzung einer Bund-Länder-Arbeitsgruppe fordert, um Belege für die Verfassungswidrigkeit der AfD zu sammeln. Bei ausreichenden Belegen will die SPD dann einen Verbotsantrag beim Bundesverfassungsgericht stellen. Klingbeil erklärte, die SPD habe die „historische Verantwortung“, juristisch gegen die AfD vorzugehen.
Hier zeigte sich, wie die AfD in Wirklichkeit benutzt wird, um die eigene rechte Politik zu rechtfertigen und autoritäre Strukturen durchzusetzen. Besonders in der Flüchtlingspolitik werden die Forderungen der AfD eins zu eins in die Tat umgesetzt. Schon vor der jüngsten Aussetzung des Familiennachzugs für schutzbedürftige Migranten hat der Bundestag im vergangenen Jahr das sogenannte „Rückführungsverbesserungsgesetz“ beschlossen, das es den Behörden erlaubt, ausreisepflichtige Menschen bis zu 28 Tage in Gewahrsam zu nehmen und sie auch mitten in der Nacht aus ihren Wohnungen zu holen.
Auch die militaristische Aufrüstung findet unter dem Jubel der AfD statt, die offen sagt, dass nun endlich ihr Programm umgesetzt werde. Die Regierungsparteien SPD und CDU/CSU verwirklichen nicht nur das Programm der AfD, sondern haben die Partei auch gefördert und in die parlamentarische Arbeit integriert. Damit haben sie rechtsextreme Positionen systematisch salonfähig gemacht.
Wenn die SPD jetzt nach einem Verbot der AfD ruft, dient das nicht dem Kampf gegen Rechts, sondern der weiteren Stärkung des staatlichen Unterdrückungsapparats. Das Sammeln von Belegen für die Verfassungswidrigkeit der AfD soll vom Verfassungsschutz durchgeführt werden. Damit soll ausgerechnet der deutsche Geheimdienst, der für seine notorische Rechtslastigkeit, die bis in die Nazi-Zeit zurückreicht, bekannt und verhasst ist, ein Gutachten darüber erstellen, welche Partei erlaubt ist und welche nicht.
Eine solche Stärkung des Geheimdienstes und des staatlichen Sicherheitsapparats richtet sich direkt gegen die große Mehrheit der arbeitenden Bevölkerung, die immer stärker mit der Politik der Aufrüstung und den damit verbunden Sozialangriffen in Konflikt gerät und sich dagegen zur Wehr setzt.
Und genau das ist das Resümee des SPD-Parteitags. Angesichts des wachsenden Widerstands gegen Kriegspolitik, Sozialkürzungen und eine regelrechte Entlassungswelle in Industrie und Verwaltung, rückt der Parteiapparat der SPD mit seinen vielen Tausend Funktionären enger zusammen, verschmilzt mit dem Staatsapparat und tritt der arbeitenden Bevölkerung immer deutlicher mit offener Feindschaft entgegen.