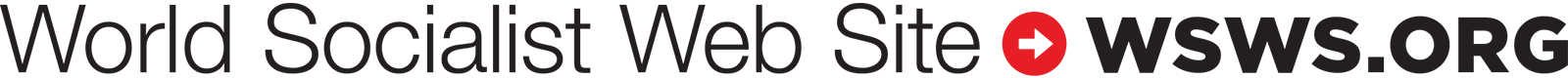Im Atlantik vor den kanarischen Inseln werden drei Boote mit insgesamt mehr als 300 Flüchtlingen vermisst. Eine Suchaktion blieb bislang erfolglos. Die Zahl der in diesem Jahr auf der Flucht in die Europäische Union im Mittelmeer oder Atlantik ertrunkenen Flüchtlinge steigt damit auf mehr als 2000, und zweifellos liegt die tatsächliche Opferzahl noch weit höher.
Die Verantwortung für dieses Massensterben liegt voll und ganz bei der Europäischen Union: In ihrer Flüchtlingsabwehr schreckt sie nicht davor zurück, Menschen ertrinken zu lassen, um andere von der Flucht nach Europa abzuhalten.
Jede Woche kommen dutzende, wenn nicht hunderte Geflüchtete hinzu, die sich auf die gefährliche Seepassage gemacht, ihr Ziel aber nicht erreicht haben. Ein Sprecher der spanischen Flüchtlingshilfsorganisation Caminando Fronteras (Grenzgänger) meldete, dass zwei Boote mit jeweils rund 60 Flüchtlingen an Bord am 23. Juni vom Senegal aus gestartet seien. Seither hat sich ein noch größeres Boot mit 200 Flüchtlingen an Bord, darunter vielen Kindern, am 27. Juni von der südsenegalesischen Hafenstadt Kafountine aus auf die mehr als 1700 Kilometer lange Strecke zu den Kanarischen Inseln gewagt. Caminando Frontereas befürchtet „eine neuerliche Katastrophe“.
Familienangehörige der Flüchtlinge haben die Hilfsorganisation Caminando Fronteras informiert, nachdem der Kontakt zu den Booten abgerissen ist. Eine von der spanischen Seenotrettung eingeleitete Suchaktion blieb bislang erfolglos. Die Seenotretter fanden zwar am vergangenen Montag ein Boot mit 78 Flüchtlingen an Bord, aber dabei handelt es sich nach Angaben von Caminando Fronteras um keines der drei vermissten Boote. Meldungen, dass die 200 Flüchtlinge am Montag gefunden worden seien, erwiesen sich ebenfalls als falsch.
Auch bei den 260 Flüchtlingen, die zwischen dem 28. Juni und 9. Juli nach Angaben des senegalesischen Außenministeriums in marokkanischen Gewässern aus Seenot gerettet wurden, handelt es sich laut Caminando Fronteras um Insassen anderer Boote, und nicht um die Vermissten.
Die Suche nach den Flüchtlingen wirft ein grelles Schlaglicht auf eine der tödlichsten Seerouten der Welt. Die brutale Abschottungspolitik der Europäischen Union zwingt Flüchtlinge dazu, immer längere und gefährlichere Routen zu wählen, um vor Krieg und Elend zu fliehen. Die zu Spanien gehörenden Kanarischen Inseln liegen nur 100 Seemeilen vor der marokkanischen Küste; viele Flüchtlingsboote legen jedoch weiter südlich vom Senegal, Gambia oder Guinea aus ab.
Die Überfahrten dauern je nach Länge zwischen einem und zehn Tagen. In einem Bericht der Europäischen Union über diese westafrikanische Route heißt es: „Üblicherweise sind Migranten nach nur wenigen Tagen mit erheblichen Problemen wie Nahrungsmittel-, Wasser- und Treibstoffmangel konfrontiert.“ Dennoch hat die EU in dieser Region, genau wie im zentralen Mittelmeer, die Seenotrettung drastisch eingeschränkt.
Die spanische Regierung hat Anfang 2022 Marokko als Verwaltungsmacht der Westsahara anerkannt, und seither schiebt sie die Verantwortung für Seenotrettungsmissionen auf die marokkanische Küstenwache ab. Diese ist jedoch wesentlich schlechter ausgerüstet und benötigt viel mehr Zeit als ihr spanisches Gegenstück, um die in Seenot geratenen Menschen zu erreichen.
Ende Juni geriet ein Schlauchboot mit 60 Flüchtlingen an Bord in Seenot, das von Dakhla in der Westsahara aus aufgebrochen war. Nachdem ein spanisches Aufklärungsflugzeug die Schiffbrüchigen entdeckt hatte, dauerte es noch über zwölf Stunden, bis ein Patrouillenboot der marokkanischen Küstenwache an der Unglücksstelle anlangte. Nur 24 Menschen konnten da noch gerettet werden.
„Die Menschen in diesem Schlauchboot hofften seit mehr als zwölf Stunden vergeblich auf Rettung in spanischen Gewässern“, erklärte Helena Maleno Garzon, Gründerin von Caminando Fronteras, in einem Social-Media-Post.
Auch die Hilfsorganisation Alarm Phone, die Notrufe von Flüchtlingen in Seenot entgegennimmt und weiterleitet, kritisiert die Ausdehnung des marokkanischen Zuständigkeitsbereichs für die Seenotrettung scharf. „Dies ist sehr besorgniserregend, denn die marokkanischen Behörden haben sich wiederholt unwillig gezeigt, eine sichere und schnelle Rettung durchzuführen – oft auf Kosten von Menschenleben“, heißt es in einem Bericht vom September 2022. Hinzu kommt, dass Marokko keine Rettungsboote, sondern Kriegsschiffe losschickt und die aufgegriffenen Flüchtlinge in die Länder deportiert, aus denen sie geflohen sind.
Im Atlantik sterben täglich vier Geflüchtete
Allein auf der Route zu den Kanarischen Inseln sind nach Angaben von Caminando Fronteras in den ersten sechs Monaten dieses Jahres bereits 778 Flüchtlinge bei 28 Bootsunglücken ertrunken. Und da sind die 300 vermissten Flüchtlinge noch nicht mit eingerechnet. Jeden Tag sterben demnach mehr als 4 Menschen auf ihrer Flucht im Atlantik. In den Jahren 2020 bis 2022 sind insgesamt sogar mehr als 7500 Flüchtlinge auf dem Weg zu den Kanarischen Inseln ertrunken. Bei insgesamt 60.000 Flüchtlingen, deren Ankunft registriert worden ist, liegt die Todesrate bei mehr als 10 Prozent.
Die Zahlen von Caminando Fronteras übersteigen die Zahlen des Missing Migrants Project der Internationalen Organisation für Migration (IOM) deutlich, da auch Angaben von Familienangehörigen, die ihre Verwandten vermissen, mit eingerechnet werden. Die IOM, die für dieses Jahr bislang „nur“ 200 ertrunkene Flüchtlinge auf der Atlantikroute registriert hat und sich auf offizielle Angaben beruft, spricht selbst davon, dass es sich „um eine vorsichtige Schätzung handelt“, und dass die tatsächlichen Opferzahlen weitaus höher liegen.
Am vergangenen Mittwoch wurden acht Leichen aus einem Holzboot vor der Küste Senegals geborgen, 155 Flüchtlinge konnten bei diesem Vorfall gerettet werden. Wenige Tage zuvor kenterte ein Boot mit 57 Flüchtlingen an Bord, von denen nur 50 lebend gerettet werden konnten. Anfang Juli starben 51 Flüchtlinge, darunter drei Kinder, bei dem Versuch, vom Süden Marokkos aus auf die Kanaren überzusetzen. Ein Motorschaden hatte dazu geführt, dass ihr Schlauchboot mehr als eine Woche lang manövrierunfähig im Atlantik trieb. Rettungskräfte fanden nur noch vier Überlebende vor.
Mehdi Lahlou, Migrationsexperte am Nationalen Institut für Statistik und angewandte Wirtschaft in Marokko, erklärt gegenüber der Deutschen Welle: „Aufgrund verstärkter Kontrollen in Nordmarokko, Libyen und Tunesien wählen Migranten aus den Ländern Nordwestafrikas vermehrt die Route über die Kanarischen Inseln.“ Angesichts der Risiken der Überfahrt sei aber eine professionelle und koordinierte Seenotrettung zwingend erforderlich. Tatsächlich werden Rettungsmissionen aber viel zu spät eingeleitet, sind schlecht koordiniert und mangelhaft ausgerüstet. Caminando Fronteras kritisiert daher, dass die spanischen und marokkanischen Behörden „anstelle der Verteidigung des Rechts auf Leben nur von dem geopolitischen Interesse geleitet sind, die Zuwanderung zu kontrollieren und zu begrenzen“.
Vereinbarung der EU mit Tunesien
Die Europäische Union schiebt die Verantwortung für die Seenotrettung ganz bewusst auf die Länder ab, aus denen die Flüchtlingsboote ablegen. Sie verhindert damit, dass aus Seenot gerettete Flüchtlinge in europäische Häfen gebracht werden müssen, und nimmt dabei den Tod von tausenden Flüchtlingen in Kauf. So hat die EU die Zusammenarbeit mit der libyschen Regierung und libyschen Warlords in den letzten Jahren intensiviert, was zur Folge hat, dass Flüchtlinge in libyschen Internierungslagern unter grausamen Bedingungen festgehalten, misshandelt und als Sklaven verkauft werden.
Zuletzt hat die EU mit der tunesischen Regierung Vereinbarungen zur Flüchtlingsabwehr getroffen. Vorausgegangen waren hochrangige Besuche von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen zusammen mit der faschistischen Ministerpräsidentin Italiens, Giorgia Meloni, und dem niederländischen Ministerpräsidenten Mark Rutte, sowie ein Besuch des deutschen Bundeskanzlers Olaf Scholz gemeinsam mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron.
Sie machten dem tunesischen Präsidenten Kais Saied ihre Aufwartung, der kurz zuvor noch vom EU-Parlament wegen Menschenrechtsverletzungen und seines autoritären Regierungsstils gerügt worden war. Die EU hat Saied mindestens 100 Millionen Euro für die Flüchtlingsabwehr zugesagt und will Boote und weitere Ausrüstung liefern.
Die tunesischen Behörden begannen unmittelbar im Anschluss daran, die ihnen zugespielte Rolle des Wachhunds der europäischen Außengrenzen mit äußerster Brutalität und Rücksichtslosigkeit wahrzunehmen. Hunderte Flüchtlinge aus der tunesischen Hafenstadt Sfax sind in Busse verfrachtet und im tunesisch-libyschen oder im tunesisch-algerischen Grenzgebiet ohne jede Versorgung ausgesetzt worden. Ein Augenzeuge berichtete der Nachrichtenagentur AFP, dass zwei Konvois mit Flüchtlingen in die Grenzregion gebracht worden seien. Der 25-jährige Ivorer Youssouf Bilayer berichtete, sie seien „in sechs Bussen transportiert und im Wald ausgesetzt worden. Sie schlugen uns, damit wir austeigen.“
Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch (HRW) geht davon aus, dass unter den Hunderten derart ausgesetzten Flüchtlinge viele Kinder sind. Wenn sie nicht schnellstens Hilfe erhalten, ist ihr Leben ernsthaft in Gefahr. Nach Angaben von HRW sollen bereits mehrere Menschen gestorben sein. Eine hochschwangere Frau aus Guinea starb, als infolge des Stresses ihre Wehen einsetzten, und mit ihr starb auch ihr Baby.
Mamadou, der aus Gambia geflohen war, sprach am Telefon mit AFP. „Wenn ihr das Rote Kreuz schicken könnt, dann helft uns – sonst werden wir sterben. Hier gibt es nichts. Es gibt kein Essen, kein Wasser.“ Am nächsten Tag war Mamadou nicht mehr erreichbar. Nach Angaben von HRW zerstören die tunesischen Sicherheitskräfte systematisch die Mobiltelefone der Flüchtlinge. Die Region sei zudem extrem verlassen und militarisiert, so dass eine Hilfsaktion nicht möglich sei. Die tunesische Regierung biedert sich mit diesem unmenschlichen und mörderischen Vorgehen bei der EU an, um dringend benötigte Kredite und Finanzhilfen zu erhalten.
Der Untergang der Adriana
Die Mitgliedsstaaten der EU selbst schrecken nicht mehr davor zurück, Flüchtlinge an den Außengrenzen Europas bewusst sterben zu lassen. Das belegt exemplarisch der Untergang der Adriana am 14. Juni vor der griechischen Hafenstadt Pylos. Gegen die Behauptungen der griechischen Behörden liegen inzwischen erdrückende Beweise dafür vor, dass ihre eigene Küstenwache das Kentern der Adriana absichtlich herbeigeführt und 600 Flüchtlinge auf diese Weise ermordet hat.
Ein Untersuchung des deutschen NDR, des britischen Guardian, der Rechercheagentur Forensis und der griechischen Organisation Salomon kommen zu dem eindeutigen Ergebnis, dass die Adriana von der griechischen Küstenwache in Richtung italienische Gewässer gezogen worden ist und anschließend, als dies erfolglos blieb, zum Kentern gebracht wurde.
Das Rechercheteam sprach mit 26 Überlebenden, wertete die vorliegenden Gerichtsakten aus und untersuchte die Logbucheinträge der beteiligten Schiffe. Danach erreichte das Küstenwachschiff 920 schon am 13. Juni um 22:40 Uhr die Adriana, die gerade vom Tanker Faithful Warrior Wasser, Essen und Treibstoff bekommen hatte. Videoaufnahmen zeigen, dass die völlig überladene Adriana hier bereits bedrohlich schwankte, und dass eine sofortige Rettungsaktion hätte eingeleitet werden müssen.
Zuvor war die Adriana aufgrund eines ausgefallenen Kompasses und fehlenden Treibstoffes stundenlang herumgeirrt, nur von der Strömung getrieben. Aber nach Eintreffen der Küstenwache bewegte sie sich wieder mit gleichmäßiger Geschwindigkeit in Richtung Italien. Überlebende berichten, dass die griechische Küstenwache sie geleitet und behauptet habe, dass ein italienisches Küstenwachtschiff bereits auf sie warte.
Gegen 1:40 Uhr am Morgen des 14. Juni stoppte die Adriana erneut, offensichtlich war der Motor wieder ausgefallen. Danach bewegte sie sich einige hundert Meter Richtung Osten, was nicht durch Wind oder Strömung zu erklären ist. Augenzeugen berichten, dass nach dem erneuten Motorschaden maskierte Männer vom griechischen Küstenwachtschiff herübergekommen seien und ein Tau am Bug der Adriana befestigt hätten.
Dazu passt, dass das Küstenwachtschiff 920 von Chania auf Kreta aus ausgelaufen war und laut Logbucheintrag ein vierköpfiges Team der in Chania stationierten KEA an Bord genommen hatte. Die KEA ist eine militärische Einheit, die darauf spezialisiert ist, gefährliche Operationen auf See auszuführen.
Die Küstenwache behauptet, das Tau sei zur Stabilisierung der Adriana befestigt worden. Der Experte für Schiffssicherheit, Stefan Krüger, äußerte jedoch gegenüber dem NDR starke Zweifel an dieser Version. „So ein krängendes Moment, was man ja durch so ein Tau auf jeden Fall anbringt, führt nicht dazu, dass das Schiff stabilisiert wird.“ Krüger glaube eher, „dass die Motivation gewesen ist, das Schiff abzuschleppen, weil der Motor nicht mehr funktioniert hat“. Nur kurze Zeit nach dem Anbringen des Taus kenterte die Adriana.
Gegenüber der britischen BBC erzählten zwei Überlebende, die aus Angst vor den griechischen Behörden anonym bleiben wollen, den Hergang des Kenterns. „Sie befestigten ein Seil von links. Alle gingen auf die rechte Seite unseres Bootes, um es auszubalancieren. Das griechische Schiff entfernte sich schnell und brachte unser Boot zum Kippen. Sie zogen es noch eine ganze Weile mit sich.“
Gegenüber dem Guardian berichtete ein anderer Überlebender, dass griechische Soldaten das Tau befestigt hätten und die Adriana etwa 10 Minuten lang gezogen worden sei. „Ich habe das Gefühl, dass sie versucht haben, uns aus dem griechischen Wasser zu verdrängen, damit ihre Verantwortung endet.“ Andere Überlebende sprachen davon, dass die Adriana sich plötzlich „wie eine Rakete“ nach vorne bewegt habe obwohl der Motor nicht lief.
Dass die Version der griechischen Küstenwache nicht mit dem tatsächlichen Hergang übereinstimmt, belegen auch die Aussagen der Überlebenden vor dem Untersuchungsrichter, der mit dem Untergang der Adriana befasst ist. Die von der Küstenwache aufgezeichneten und veröffentlichten Aussagen sind danach unter Druck zustande gekommen und manipuliert.
Wie der Guradian berichtet, stimmen die Aussagen, die zwei Überlebende unterschiedlicher Nationalität laut Angabe der Küstenwache gemacht haben sollen, erstaunlicherweise Wort für Wort überein: „Wir waren mit zu vielen Leuten auf dem Boot, das alt und rostig war ... Deshalb kenterte es und sank schließlich.“
Doch unter Eid vor dem Staatsanwalt haben dieselben Überlebenden Tage später die griechische Küstenwache für den Untergang verantwortlich gemacht. Ein Überlebender, der in seiner Aussage bei der Küstenwache angab, dass der Trawler aufgrund seines Alters und seiner Überbelegung gekentert sei, sagte später aus: „Als sie das Boot betraten (und es tut mir leid, das zu erwähnen), sank unser Boot. Ich glaube, der Grund war das Abschleppen durch das griechische Boot.“
Gegenüber der BBC berichteten Überlebende, dass sie von der Küstenwache eingeschüchtert worden seien. Immer wenn gesagt wurde, dass die griechische Küstenwache das Kentern herbeigeführt habe, sei ihnen gesagt worden, sie sollten den Mund halten. „Ihr habt den Tod überlebt! Hört auf, über den Vorfall zu sprechen! Stellt keine Fragen mehr dazu!“
Noch weitere Vorkommnisse sind ans Licht gekommen, die belegen, dass die griechische Küstenwache zu keinem Zeitpunkt daran interessiert war, die Flüchtlinge zu retten. Und auch die europäische Grenzschutzagentur Frontex blieb erwiesenermaßen untätig, obwohl sie frühzeitig darüber informiert war, dass ein klarer Seenotrettungsfall vorlag.
Nach Informationen der Welt am Sonntag soll das Boot laut einem internen Frontex-Dokument bereits um 6:51 Uhr erstmals von italienischen Behörden gesichtet worden sein. Frontex behauptete bislang, erst um 9:47 Uhr durch eine Aufklärungsdrohne vom überladenen Schiff erfahren zu haben. Tatsächlich alarmierte die Seenotrettungsstelle in Rom schon um 8:51 Uhr sowohl Frontex als auch die Leitstelle in Piräus, von wo aus Rettungseinsätze der griechischen Küstenwache gesteuert werden. Bestandteil der Information soll auch gewesen sein, dass an Bord des Fischtrawlers zwei Kinder verstorben seien.
Dennoch dauerte es Stunden, bis das griechische Küstenwachtschiff 920 von Kreta aus ablegte. Fraglich bleibt, warum nicht die viel näher gelegenen Boote in Kalamata, Pylos oder Patras alarmiert und losgeschickt wurden. Gegenüber dem Guardian äußerte ein Angehöriger der griechischen Küstenwache sein völliges Unverständnis dafür, dass nicht sofort eine Rettungsaktion eingeleitet worden sei: „Es war eine Situation, in der man alles schickt, was man hat. Der Trawler war eindeutig auf Hilfe angewiesen.“
Offensichtlich ging es den griechischen Behörden aber darum, Angehörige der in Chania stationierten KEA mit an Bord zu nehmen, um das Schiff aus griechischen Gewässern zu entfernen. Eine tatsächliche Rettungsaktion war demnach zu keinem Zeitpunkt geplant.
Die griechische Küstenwache hat inzwischen bestätigt, frühzeitig von italienischen Behörden informiert worden zu sein. Der neu ernannte griechische Migrationsminister Dimitris Kairidis sagte in Brüssel, dass „eine unabhängige gerichtliche Untersuchung“ stattfinde. Sofern jemand für schuldig befunden werde, „wird es definitiv Konsequenzen geben“. Bis dahin solle man „keine voreiligen Schlüsse ziehen und sich nicht dem politischen Druck beugen“.
Die europäische Grenzschutzagentur Frontex hat zwar pro forma eine eigene Untersuchung des Untergangs eingeleitet. Aber gleichzeitig stellt sich die EU-Kommission weiter hinter die Ermittlungen der griechischen Behörden. Diese konzentrieren sich jedoch weiter auf die neun nach dem Schiffsunglück festgenommenen Ägypter, die angeblich das Boot gesteuert und Wasser und Essen verteilt haben sollen.
Diesen neun Personen wird vorgeworfen, einem Menschenschmugglerring anzugehören und das Kentern des Schiffes herbeigeführt zu haben. Im Falle einer Verurteilung droht ihnen eine lebenslange Haftstrafe. Dabei haben Überlebende der BBC berichtet, dass die Küstenwache sie gezwungen habe, diese neun als Drahtzieher und Menschenschmuggler zu bezeichnen. „Die griechischen Behörden haben sie inhaftiert und zu Unrecht beschuldigt, um ihr eigenes Verbrechen zu vertuschen“, erklärte ein Überlebender.
Der Untergang der Adriana, der mehr als 600 Flüchtlinge in den Tod riss, ist offenbar ein absichtlicher oder durch unterlassene Hilfeleistung herbeigeführter Massenmord, den die EU zu verantworten hat.