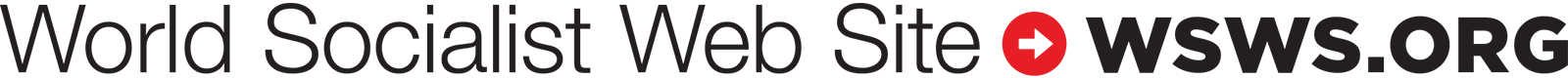Stöße, Faustschläge und schmerzhafte Polizeigriffe, Fesselung und Fixierung, Verdrehung der Gliedmaßen, Würgen und Treten, auch Angriffe mit dem Taser oder mit Pfefferspray, Einsätze mit Polizeihunden und Wasserwerfern – lang ist die Liste der Übergriffe, mit denen die Polizei in Deutschland ihre Opfer traktiert. Damit nicht genug, kommt für die Betroffenen hinzu, dass Korpsgeist und Nähe zur Justiz die Aufarbeitung und Ahndung der Delikte praktisch verhindern.
Dies sind die Ergebnisse einer groß angelegten Studie, die der Kriminologe Tobias Singelnstein und sein Team Anfang Mai an der Goethe-Universität Frankfurt vorgelegt haben. Das Dokument „Gewalt im Amt. Übermäßige polizeiliche Gewaltanwendung und ihre Aufarbeitung“ kann beim Campus Verlag kostenlos heruntergeladen werden. Sein Inhalt belegt nicht nur ein erschreckendes Ausmaß an Polizeigewalt, sondern auch, dass sie für die Täter praktisch folgenlos bleibt.
Anlass für die Studie, die von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) unterstützt wurde, war offensichtlich die breite öffentliche Debatte über Polizeigewalt, die der G20-Gipfel in Hamburg losgetreten hatte. Unter dem damaligen Ersten Bürgermeister Hamburgs und heutigen Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) wurde der Belagerungszustand über die Stadt verhängt und gegen Protestierende und unbeteiligte Zuschauer eine maßlose Polizeigewalt entfesselt.
Der Hamburger G20-Gipfel wird von Singelnstein in der Einleitung als „prominentes Beispiel für fehlende Aufarbeitung übermäßiger polizeilicher Gewalt“ genannt. Daneben verweist er auf den Fall des 16-jährigen Senegalesen Mohamed Lamine Dramé, den Dortmunder Polizisten mit mehreren Schüssen aus einer Maschinenpistole getötet hatten, und andere Fälle. Sie hätten eine bisher unbeantwortete Kontroverse über den Einsatz von Gewaltmitteln ausgelöst. Tatsächlich war der Mord an Dramé in Dortmund nur einer von vier polizeilichen Tötungen in nur einer einzigen Woche.
Die Ergebnisse der jüngsten Studie zeigen nun, dass exzessive – und straflose – Gewaltanwendung für die Polizei praktisch zum Alltag gehört. Die Konsequenzen, die Professor Singelnstein aus seinen eigenen Forschungsergebnissen zieht, sind dagegen eher zahnlos: Er empfielt die Respektierung der unabhängigen Justiz, daneben die Einführung einer individuellen Kennzeichnung und von Bodycams bei der Polizei aller Bundesländer.
Dabei ist der größere Zusammenhang offensichtlich: Die immer brutaleren Polizeiexzesse und ihre Duldung durch den kapitalistischen Staat und seine Parteien können nur als Antwort auf einen neuen Aufschwung im Klassenkampf verstanden werden. Die Unzufriedenheit mit der Ampel-Koalition in Berlin, die immer offener auf Krieg und soziale Ungleichheit setzt, mündet zwangsläufig in gesellschaftlichen Widerstand. Da keine etablierte Partei die Interessen der breiten Bevölkerung vertritt, greift der Staat immer direkter auf seine Gewaltorgane, auf Polizei, Justiz und Bundeswehr zurück, um die schmale reiche Oberschicht gegen die Arbeiterklasse zu verteidigen.
Ähnliches sieht man derzeit in Frankreich, wo die Staatsorgane fast täglich mit großer Härte gegen Protestierende vorgehen, oder in den Vereinigten Staaten, wo es mittlerweile mehrmals täglich zu tödlichen Polizeischüssen kommt. Auch in Deutschland ist das Ausmaß an Polizeigewalt, das die Studie „Gewalt im Amt“ jetzt dokumentiert, nur in diesem Rahmen verständlich.
Es sei das erste Mal, so das Team um Professor Singelnstein, dass „eine groß angelegte quantitative Befragung von Betroffenen polizeilicher Gewaltanwendung“ durchgeführt worden sei. Über vertrauensbildende Mittelspersonen („Gatekeeper*innen“) haben die Autoren fast 6000 Personen aus schwer erreichbaren, vulnerablen oder stigmatisierten Gruppen ausfindig gemacht und 3373 von ihnen, die definitiv von Polizeigewalt betroffen waren, ausführlich befragt. Anschließend kamen 63 Interviewpartner aus Polizei, Justiz und Staatsanwaltschaft sowie Anwälte und Opferberater zu Wort. Nach fünf Jahren Forschungsarbeit liegt das Ergebnis der Analyse jetzt vor.
Sein Inhalt ist erschreckend. So berichteten 19 Prozent aller Befragten von schweren Verletzungen, etwa an Gelenken und Sinnesorganen, und von Knochenbrüchen. Bei den Einsätzen außerhalb von Großveranstaltungen war sogar fast jeder Vierte (25 Prozent) betroffen. Die Gefahr schwerer Verletzungen erhöhte sich vor allem, wenn es zu Würgen und Fesselungen kam. Auch über Gewalt im Polizeigewahrsam wurde häufig berichtet.
Das Team teilte die Betroffenen in drei große Kategorien ein: Erstens Demonstrationen und große Veranstaltungen politischer Natur (55 %), zweitens Fußball- und andere Massenevents (25 %) und drittens Konflikte bei Personenkontrollen und ähnlichen Situationen außerhalb von Großveranstaltungen (20 %).
Nur bei 16 Prozent der Teilnehmenden wurde ein Migrationshintergrund festgestellt; das ist ein geringerer Anteil als an der Gesamtbevölkerung. Der größte Anteil mit Migrationshintergrund und von People of Color (PoC) zeigte sich in Konflikten, die sich außerhalb von Großveranstaltungen ereigneten: bei Personen- und Verkehrskontrollen, Einsätzen gegen Dritte, Wohnungs- und Haussuchungen, Abschiebungen, etc.
Einen großen Dunkelbereich räumte das Forschungsteam bei den Abschiebungen ein. Hier lagen ihm praktisch nur indirekte Berichte vor, die aus den Interviews mit Anwälten und Beratungsstellen stammten, da direkt Betroffene für die Studie kaum erreichbar waren.
Die Beschäftigte einer Beratungsstelle sagte: „Am meisten haben wir arbeitstechnisch eigentlich mit Polizeigewalt bei Abschiebungen zu tun, und da speziell geht es um Sedierung, um Fesselung, Erniedrigung, Schläge und (…) einfach herabsetzendes Verhalten, entwürdigendes Verhalten durch Polizeibeamte et cetera.“
Die Brutalität des Vorgehens wird aus einem Bericht deutlich, bei dem ein Augenzeuge versuchte, Polizeigewalt mit dem Handy zu filmen. Darin geht es um den Fall
… von einem syrischen Flüchtling, der eine Festnahme von einem Afrikaner gefilmt hat, weil die Beamten sich auf den Rücken gesetzt haben. Und der Festgenommene hat geschrien, er kriegt keine Luft mehr, er kriegt keine Luft mehr, und die Beamten haben trotzdem weitergemacht. Und dann hat er das gefilmt … und dann haben sie ihm sozusagen so den Arm gebrochen, auch spiral, damit er das Handy fallen lässt. Und der hat auch bis heute – das ist ein Jahr her – der hat bis heute Schmerzen. Und das [Verfahren] wurde auch eingestellt, obwohl da sogar Zeug*innen dabei waren, die das gesehen haben, und er wurde angeklagt wegen Körperverletzung. Standard.
Unnötig gewaltsam geht die Polizei oft auch mit psychisch gestörten Menschen um. Da sei schnell das Vorurteil der „drei Bs“ zur Hand: „betrunken, bekloppt, bekifft“, wie ein Polizist im Interview einräumte. Dadurch werde die Hemmschwelle stark herabgesetzt, die Betreffenden würden geduzt, oft auch willkürlich verletzt (da alkoholisierte und unter Drogen stehende Menschen angeblich „weniger schmerzempfindlich“ seien).
An anderer Stelle gibt ein Polizist im Interview zu, dass unter seinen Kollegen selbstgedrechselte „japanische Massagestäbe“ kursierten. Sie würden an einem Bändchen im Ärmel befestigt und könnten in unbeobachteten Momenten dazu dienen, den Opfern an bestimmten Körperstellen große Schmerzen zuzufügen.
Erschreckend ist nicht nur die Studie, erschreckend ist auch die Art und Weise, wie große Tageszeitungen darauf reagiert haben. Die Süddeutsche Zeitung befragte zu ihrem Inhalt ausgerechnet den notorisch rechten Polizeiideologen Rainer Wendt, Vorsitzender des reaktionären Berufsverbandes Deutsche Polizeigewerkschaft (DPolG). Dieser behauptete: „Es gibt kein strukturelles Problem mit Gewaltanwendung in der Polizei“.
Die Forderung nach individueller Kennzeichnungspflicht von Polizeibeamten bezeichnete Wendt als „politisches Kampfinstrument linker Parteien, um die Polizei öffentlich zu diskreditieren und ihre Beschäftigten unter Generalverdacht rechtswidriger Gewaltanwendung zu stellen“.
Wendts freche Behauptung, die Vorwürfe gegen Polizisten seien haltlos und unbegründet, stützen sich auf die verheerende Praxis der deutschen Justiz und Staatsanwaltschaften, die kaum jemals eine Anzeige – so selten sie auch sind – zur Gerichtsverhandlung bringen und die Beschuldigten noch seltener verurteilen. Es war gerade ein erklärtes Ziel der Studie, auch das Dunkelfeld derjenigen Fälle zu beleuchten, die niemals vor Gericht verhandelt werden.
Die Ergebnisse der Studie sind eindeutig: Obwohl die Fälle von Körperverletzung im Amt zunehmen, ist es äußerst selten, dass sie jemals zur Anzeige kommen. Die überwältigende Mehrheit der Befragten entschied sich gegen eine Anzeige, weil sie von deren Erfolglosigkeit ausgingen. Meist konnten sie die polizeilichen Täter nicht identifizieren. Hinzu kam auch die berechtigte Angst vor einer Gegenanzeige der beschuldigten Polizisten.
Weniger als zehn Prozent (9,2 %) der Befragten gaben an, Anzeige erstattet zu haben, meist mit der Begründung, damit „so etwas nicht noch einmal passiert“. Von dem kleinen Teil der Fälle, die überhaupt zur Anzeige kamen, wurden die allermeisten wegen „Geringfügigkeit“ oder „mangels hinreichenden Tatverdachts“ eingestellt.
Zum Vergleich führt die Studie die statistischen Zahlen aus dem Jahr 2021 an, als nur 2,3 % der Anklagen wegen rechtswidriger Gewaltausübung durch Polizisten verhandelt und fast 98 % eingestellt wurden. Und von den 80 angeklagten Polizisten, die im Jahr 2021 tatsächlich in einem Hauptverfahren vor Gericht standen, wurde am Ende nur jeder dritte (27 Personen) verurteilt – ein völlig unterdurchschnittlicher Anteil.
Singelnstein räumte ein, dass diese Ergebnisse selbst ihn, den Experten, am Ende überrascht hätten: „Wie gering doch die Beschwerdemacht der Betroffenen ist, und wie groß im Gegensatz die Definitionsmacht der Polizei.“
Die Studie bringt relativ klar zum Ausdruck, dass es im Wesentlichen Klassenfragen sind, die die Polizeigewalt auslösen. Ins Visier geraten vor allem Personen, die auf der sozialen Stufenleiter ganz unten stehen und über keinerlei Lobby verfügen. Ein Anwalt wird mit den Worten zitiert:
Ich denke, je randständiger das Milieu des Beschuldigten, Kontrollierten oder so ist, desto größer ist halt auch die Neigung, dass da etwas härter zugegriffen wird, wenn irgendetwas eskaliert, ne? … das ist jetzt aber eine rein gefühlsmäßige Sache – dass halt sozusagen Ausländer, Asylbewerber jetzt nicht im Sine von … Es gibt ja auch viele deutsche Türken hier, … die sind ja deutsche Staatsbürger. Aber halt von der ethnischen Herkunft her, dass die glaube ich schon eher Gefahr laufen, ich sage mal, im Zweifelsfalle härter angepackt zu werden.
Bei Demonstrationen wird als Hauptfaktor (80 %) für eine übermäßig gewaltsame Polizeibehandlung die „politische Einstellung“ genannt. Bei Ereignissen außerhalb von Großveranstaltungen steht die politische Einstellung mit über 40 % an zweiter Stelle für Gewaltanwendung, noch vor Faktoren wie Alter, Geschlecht oder ethnischer Zugehörigkeit. Fast alle, die von polizeilicher Gewalt im Rahmen einer Demonstration oder politischen Aktion berichteten, bezeichneten sich selbst als „eher links“.
Besonders häufig geraten Personengruppen ins Visier der Polizei, die als „sozioökonomisch schlechter gestellt“ wahrgenommen werden und bei denen „keine rechtliche Gegenwehr zu erwarten“ ist. Dies betreffe, so die Studie, „marginalisierte Gruppen wie rassifizierte Personen, LGBTIQ*Personen, Wohnungslose oder andere subalterne Gruppen“, sowie People of Color (PoC). Darin weist besonders die Erwähnung von Wohnungslosen und „Subalternen“ auf die Klassenfragen hin, um die es geht: Angehörige der Arbeiterklasse, ob als Berufstätige, Arbeitslose oder Geflüchtete, werden besonders häufig Opfer von Polizeigewalt.
Ein Interview mit einem Polizisten dokumentiert die rechtsextreme Stimmung und militaristische Sprache, die unter Polizeikräften kursiert:
Naja, es kommt eben drauf an, wie der Befehl gerade lautet. Wenn eine hohe Einschreitschwelle ist, dann lässt du dich da zwei Stunden anrotzen und dann auf einmal heißt es: „Jetzt dürft ihr!“ – und dann ist Polen offen.